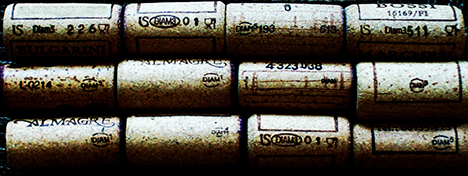“Dank eines exklusiven patentierten Verfahrens zur ‘Entaromatisierung’ von
Kork, sind die
Korken ‘Diam’ und ‘Mytik Diam’ die einzigen Korkverschlüsse, die
sensorisch vollkommen neutral sind”, verspricht der Hersteller und garantiert “die Bewahrung der Aromen des Weins während seiner gesamten Lagerzeit” sowie “einen durchgehend einwandfreien Genuss”. Dabei wird das
Korkgranulat mit der "Diamant®process"-Technologie behandelt. Nach Firmenangaben nutzt sie “die Möglichkeiten des superkritischen CO2”, mit dem “die flüchtigen und schädlichen Substanzen extrahiert und damit die Risiken von TCA-‘Korkgeschmack’ eliminiert werden sollen”. Renommierte Betriebe wie beispielsweise die
Champagner-Produzenten Mumm und Billecart Salmon,
Louis Jadot aus dem
Burgund,
Hugel et Fils im
Elsass und der renommierte französische
Weinberater Michel Rolland verwenden und werben für Diam-Korken. Am Versprechen des Unternehmens hat der Weinhändler Rolf Cordes aus dem bayerischen Mühldorf aber Zweifel. Er behauptet, Diam-Korken würden einen “untypischen Bitterton” hervorrufen. Das habe er nach vielen Jahren in der
Verkostung von Weinen aus ganz
Europa herausgefunden. Zum Beleg seiner These hat er kürzlich eine eigene sensorische Untersuchung organisiert und will die Ergebnisse nun online veröffentlichen.
Wein-Plus hat ihn zu seinen Vorwürfen, Erkenntnissen und Belegen befragt.
Wein-Plus:
Herr Cordes, sie sagen, die weltweit milliardenfach eingesetzten Agglomeratkorken des französischen Anbieters
Diam Bouchage könnten den Geschmack der damit verschlossenen
Weine negativ verändern. Wie kommen Sie darauf?
Rolf Cordes:
Bei der
Verkostung von Rot-, Rosé- und Weißweinen aus unterschiedlichen Regionen und
Rebsorten entdeckte ich geschmackliche Parallelen negativer Art. Ich machte mich auf die Suche nach dem Verursacher. Als einzige Gemeinsamkeit stellte sich bei allen Weinen der
Verschluss heraus - der Diam-Kork.
Wein-Plus:
Könnten auch
Korken aus ähnlichen Produktionsverfahren anderer Hersteller nach Ihren Beobachtungen betroffen sein?
Rolf Cordes:
Grundsätzlich gelten die herkömmlichen Agglomeratkorken als nicht
sensorisch neutral. Dieses stelle ich unabhängig vom Hersteller immer wieder fest. Die sensorischen Veränderungen jener
Korken sind aber anders und nicht so einheitlich wie bei den Diam-Korken.
Wein-Plus:
Welchen
Fehler verursachen Ihrer Ansicht nach diese
Korken? Wie lässt er sich beschreiben?
Rolf Cordes:
Den
Fehlton bezeichne ich als einen “untypischen Bitterton”,
kurz UTB. Er verursacht eine außergewöhnliche
Trockenheit vorrangig im Rachen, Gaumenzäpfchen und der Speiseröhre. Diese
Adstringenz hält länger an als bei den üblichen
Tanninen, die sich vorrangig im Mundraum und
Gaumen bemerkbar machen. Unter zunehmendem Lufteinfluss wird eine deutliche Disharmonie spürbar.
Wein-Plus:
Wann ist der
Fehler für Sie zum ersten Mal bewusst aufgetreten? Bei welchen Weinen?
Rolf Cordes:
Das lässt sich nicht sagen. Es ist wie bei einem Puzzle. Da weiß man, wenn das Bild fertig ist, auch nicht mehr, mit welchem Teil man angefangen hat.
Wein-Plus:
Sie sind sicher, dass nur Diam-Korken betroffen sind?
Rolf Cordes:
Bis jetzt habe ich diesen
Fehlton in dieser Art und Weise noch bei keinem anderen
Presskorken festgestellt. Die Einzigartigkeit wurde mir auch von dem erfahrenen Binger
Önologen Volker Schneider bestätigt. Er hat viele Jahre ein unabhängiges Weinanalyse-Labor betrieben.
Wein-Plus:
Rolf Cordes:
Ja. Ich habe acht unterschiedliche
Weine ausgewählt. Bei jedem
Wein wurde die Hälfte seiner Menge mit einem Diam-Korken in Kontakt gebracht. Ich habe dabei zwei unterschiedliche Verfahren angewandt: Zum einen waren drei
Weine in Flaschen abgefüllt, pro Sorte wurden zwei
Flaschen mit Schraubverschluss und mit
Diam verschlossen. Dazu haben wir fünf
Weine, welche mit
Schraubverschluss versehen waren, in fabrikneue 1,5l-Glasbehälter gefüllt. Je
Wein gab es einen Glasbehälter ohne
Korken und einen, der zwei
Diamkorken enthielt. Die
Weine in den Glasbehältern wurden mit Argon begast, um eine
Oxidation zu verhindern. Die drei
Flaschenweine der Gruppe 1 blieben 37 bis 94 Tage mit den Diam-Korken in Kontakt. Die fünf
Weine der Gruppe 2 hatten eine Kontaktzeit von 32 bis 72 Stunden, also maximal drei Tage. Die
Weine wurden anschließend in codierte 100ml-Flaschen
abgefüllt und an die Prüfer versandt.
Wein-Plus:
Wer waren die Prüfer?
Rolf Cordes:
Wein-Plus:
Was war das Ergebnis?
Rolf Cordes:
Die
Test belegt, dass Diam-Korken
sensorisch nicht neutral sind. Dabei ist es auf Grund des identischen Herstellungsverfahrens unerheblich, um welchen Diam-Typ es sich handelt.
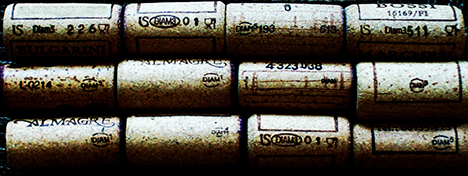 |
| Copyright: Rolf Cordes |
Wein-Plus:
Wie
hoch war die Erkennungsrate der beteiligten Tester?
Rolf Cordes:
Wein-Plus:
Warum haben Sie sich für dieses Testverfahren entschieden? Haben Sie es alleine entwickelt?
Rolf Cordes:
Eine
sensorische Prüfung entsprach genau meinen Erfordernissen. Es galt, die Wirkung auf den
Wein nachzuweisen und nicht den verursachenden
Stoff zu finden. Beraten wurde ich beim Versuchsaufbau von dem in der Forschung,
Sensorik und
Analytik sehr erfahrenen
Önologen Volker Schneider.
Wein-Plus:
Einige
Önologen sagen allerdings, der Versuchsaufbau würde wahrscheinlich jeden
Wein mit einem
Fehlton verändern - egal welchen
Verschluss man einsetzt. Wie ist Ihre Meinung dazu?
Rolf Cordes:
Es gab drei
Weine, welche mit
Diam verkorkt waren und fünf
Weine, die in einem Glasbehälter mit einem Diam-Korken in Kontakt kamen. Das zweite Verfahren ist allgemein in der Forschung üblich, um den Übergang von Stoffen in eine Lösung zu kontrollieren, etwa bei der
TCA -Prüfung von Naturkorken. Die Behauptung, dass jeder
Verschluss einen
Wein wahrscheinlich mit einem
Fehlton verändern würde, ist sehr pauschal ausgedrückt und so nicht haltbar. Sollte aber ein anderer
Verschluss einen
Fehlton unter diesen Voraussetzungen hervorrufen, wäre er meiner Meinung nach genauso streng und sorgfältig zu prüfen, wie es in diesem Fall bei
Diam geschah.
Wein-Plus:
Der Diam-Korken verspricht den völligen Ausschluss von
TCA, also Korkton. Daher wird er weltweit seit vielen Jahren eingesetzt. Wieso ist der von Ihnen beobachtete
Fehler bislang von keinem
Winzer,
Händler oder
Önologen bemerkt worden?
Rolf Cordes:
Die Grundvoraussetzung, um auf diesen
Fehlton zu stoßen, ist, ihn überhaupt zu erkennen. Vielleicht haben sie schon etwas Außergewöhnliches bemerkt, konnten es aber nicht dem
Verschluss zuordnen. Wer nach
TCA sucht, wird den UTB nicht finden. Bei der Prüfung ist es notwendig, etwas
Wein zu schlucken, andernfalls werden die wesentlichen Bereiche im Mund nicht benetzt. Nachdem häufig der Vergleich zum nicht kontaminierten
Wein fehlt, bleibt der Einfluss von
Diam unentdeckt. Allgemein werden diese Empfindungen häufig der
Säure, den
Tanninen, der
Rebsorte, dem
Klima, dem Boden und dem Entwicklungsstadium zugeschrieben. Die sich entwickelnde Disharmonie bedarf einer kontinuierlichen Beobachtung, die bei
Qualitätskontrollen und
Weinevents aus Zeitgründen nicht möglich ist.
Wein-Plus:
Was wollen Sie mit Ihren Ergebnissen erreichen?
Rolf Cordes:
Das Risiko für
Winzer und
Händler soll reduziert werden. Fehlerhafte und disharmonische
Weine sind nicht geschäftsfördernd, ganz im Gegenteil. Die Weintrinker, sprich die Kunden, haben ein Anrecht auf
Weine, die nicht durch
Verschlüsse beeinträchtigt sind. Ich bin der Meinung, dass der Hersteller
Diam Bouchage dringend die Identifizierung und Beseitigung des verursachenden Stoffes in Angriff nehmen muss.
Wein-Plus:
Haben Sie mit
Diam deswegen Kontakt aufgenommen?
Rolf Cordes:
Nein.
Wein-Plus:
Was sind Ihre nächsten Schritte?
Rolf Cordes: